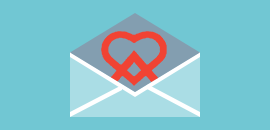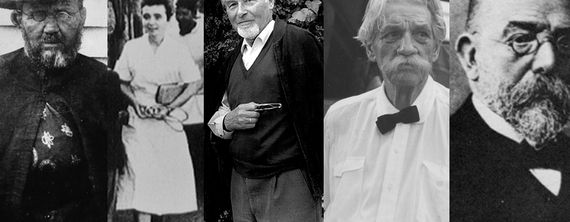Jahresbericht 2023
- News
25. Juli 2024
Waffeln für alle: DAHW-Stand auf der Kiliankirmes in Letmathe auch in diesem Jahr der Renner

DAHW-Vorstand Patrick Georg kommt extra aus Würzburg angereist, um den ehrenamtlichen Helfer:innen am traditionellen...
Mehr23. Juli 2024
Strampeln und Spenden – Traditionelle Fahrradtour für den guten Zweck in Kiel

Die 23. „Pedale Kiel“ ist bei sehr schönem Wetter wunderbar verlaufen. Das Traditionsevent brachte nicht nur gute Laune...
Mehr19. Juli 2024
Großes Interesse und viele Fragen: DAHW-Bildungsbesuch im Gymnasium Mellrichstadt

Hinduismus… die meisten haben schon davon gehört, doch was genau ist das? Das erklärte die DAHW-Bildungsreferentin...
Mehr - Imagespot
Die DAHW – eine Kurzvorstellung unserer Arbeit
1957 als Leprahilfswerk in Würzburg gegründet, ist die DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe heute Experte im Kampf gegen armutsbedingte und vernachlässigte Krankheiten. Im Fokus stehen besonders vulnerable Menschen, die von Krankheit, Behinderung, Ausgrenzung und Armut betroffen oder bedroht sind.
Doch was heißt das konkret? Wo sind wir aktiv? Welche Maßnahmen setzen wir um? Und was genau passiert in der Würzburger Zentrale der DAHW? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt dieser Videoclip.
Lepra lebt ...
Immer noch erkranken jedes Jahr über 200.000 Menschen weltweit neu an Lepra
Lepra gibt es vermutlich schon so lange, wie es die Menschheit gibt. Erwähnt wurde sie schon in chinesischen Überlieferungen und auf ägyptischen Papyri. 1873 wurde das verantwortliche Bakterium von dem Norweger Armauer Hansen entdeckt. Bei der in den 70er-Jahren entwickelten und auch noch heute von der WHO empfohlenen Therapie hat die DAHW entscheidend mitgewirkt.
Aber Lepra lebt heute noch immer
Das liegt auch daran, dass die Krankheit im extremen Fall bis zu 20 Jahre brauchen kann, bis sie ausbricht. Wird sie dann nicht schnellstmöglich behandelt, sterben oft die Nervenenden in der Haut, an Händen und Füßen ab. Dies kann dazu führen, dass die Leute bei Verletzungen die offenen Wunden nicht spüren, diese sich infizieren und es dann zu Verstümmelungen kommt. Diese Behinderungen führen dazu, dass die betroffenen Patienten kaum noch arbeiten können und sozial ausgegrenzt werden.